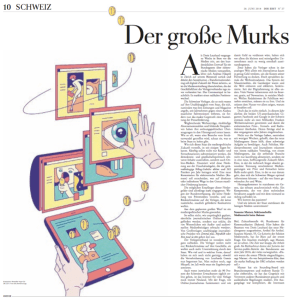Posts Tagged ‘Digitalisierung’
Breaking Blues
Innovativer Online-Journalismus für die Masse: Mit diesem Anspruch startete «Nau.ch» vor drei Jahren. Doch unter dem Druck der Corona-Krise verriet die Firma ihre eigenen Leute.
Eine Recherche, erschienen am 31. Juli 2020 im Onlinemagazin Republik und geschrieben gemeinsam mit Philipp Albrecht.
Während der Pandemie schickt «Nau» fast alle seiner rund 50 Angestellten in die Kurzarbeit. Warum die Geschäftsleitung verhindern wollte, dass dieser Fakt an die Öffentlichkeit gelangt, ist unklar. Möglicherweise wollte der CEO mit seiner Reaktion verschleiern, dass die aufstrebende Jungfirma plötzlich auf staatliche Krisenhilfe angewiesen war. Es hätte als Zeichen von Schwäche gedeutet werden können – auch wenn im gleichen Zeitraum Hunderttausende andere Firmen ebenfalls Kurzarbeit beantragt hatten.
Besonders merkwürdig erscheint in diesem Zusammenhang der Abbau von 9 Stellen Ende Mai, obwohl das Instrument der Kurzarbeit Kündigungen gerade verhindern soll.
Nach Gesprächen mit über einem Dutzend Quellen aus dem Umfeld von «Nau» stellt sich heraus, dass die Entlassungen nur 15 Tage nach dem Ende der Kurzarbeitsphase ausgesprochen wurden. Und es steht der Vorwurf im Raum, dass die Nau Media AG die Kurzarbeitsentschädigung zumindest teilweise missbräuchlich bezogen haben könnte. Denn die Redaktorinnen wurden nach mehreren übereinstimmenden Aussagen dazu motiviert, Überstunden zu leisten.
CEO Kilchenmann stellt dies in Abrede. «Die Kurzarbeit und die Kündigungen stehen in keinem direkten Zusammenhang», schreibt er auf Anfrage. Die Kündigungen begründet er mit «Marktveränderungen». Was das genau bedeutet, lässt er offen.
Der grosse Murks
Gespannt wartete die Branche auf das neue Mediengesetz von Bundesrätin Doris Leuthard. Nun ist es da – und niemand ist zufrieden. Warum?
Ein Hintergrundartikel, erschienen am 28. Juni 2018 in der Schweizer Ausgabe der deutschen Wochenzeitung DIE ZEIT.
Als Doris Leuthard vergangene Woche in Bern vor die Medien tritt, um den bundesrätlichen Entwurf für ein Bundesgesetz über elektronische Medien vorzustellen, lehnt sich Andreas Häuptli in Zürich auf seinem Bürostuhl zurück und drückt den Sendebutton. «Transformationsbeitrag soll digitale Zukunft der Presse sichern», ist die Medienmitteilung überschrieben, die der Geschäftsführer des Verlegerverbandes tags zuvor vorbereitet hat. Das Communiqué ist beachtlich: Es markiert einen radikalen Positionswechsel.
Die Schweizer Verleger, die so stolz waren auf ihre Unabhängigkeit vom Staat, die sich, zumindest was ihre Zeitungen und Magazine angeht, seit Jahrzehnten gegen einen Ausbau staatlicher Subventionen wehrten, sie fordern nun das exakte Gegenteil: eine Ausweitung der Presseförderung.
Wegbrechende Werbeerträge, rückläufige Abonnementszahlen und fehlende Perspektiven haben ihre ordnungspolitischen Überzeugungen in den Hintergrund treten lassen. Wie so oft, wenn eine Branche vom Strukturwandel getroffen wird, schaut sie, was es beim Staat zu holen gibt.
Wie sich dieser Staat die medienpolitische Zukunft vorstellt, ist seit einigen Tagen bekannt. Künftig sollen nicht nur Radio- und Fernsehstationen subventioniert werden, die demokratie- und gesellschaftspolitisch relevante Inhalte ausstrahlen, sondern auch Online-Medien. Finanziert wird diese Förderung aus der Haushaltsabgabe, die die geräteabhängige Billag-Gebühr ablöst und 365 Franken pro Jahr betragen wird. Eine neue Kommission für elektronische Medien (Komem) soll entscheiden, wer auf direktem oder indirektem Wege in den Genuss staatlicher Förderung kommt.Die möglichen Empfänger dieser Fördergelder sind allerdings stark eingegrenzt. Wegen der Bundesverfassung, die keine Förderung von Printmedien vorsieht, und aus Rücksichtnahme auf die Verleger, die keine zusätzliche, staatlich geförderte Konkurrenz wollen.
Aus dem geplanten großen Wurf ist ein medienpolitischer Murks geworden. So sollen nicht, wie ursprünglich geplant, sämtliche journalistischen Online-Projekte gefördert werden, sondern nur solche, die «im Wesentlichen mit Audio- und audiovisuellen Medienbeiträgen erbracht werden». Von Großverlagen unabhängige journalistische Projekte wie Zentral plus, Republik oder Bon pour la tête gehen leer aus.
Der Verlegerverband ist trotzdem nicht ganz zufrieden. Die Verleger wollen nicht nur Rücksichtnahme auf ihre Geschäfte, sie wollen auch mehr Unterstützung durch den Staat. Wie viel und in welcher Form, darauf haben sie sich noch nicht geeinigt, obwohl die Vernehmlassung von Leuthards Gesetz nun begonnen hat. Man rechne noch, sagt Häuptli, im Juli wolle man ein Ergebnis präsentieren.
Auch wenn inzwischen mehr als 90 Prozent der Schweizer Erwachsenen täglich online gehen, ist das Internet für viele Verlage noch immer Neuland. Mit der Frage, wie Online-Journalismus funktioniert und wie damit Geld zu verdienen wäre, haben sich vor allem die kleinen und mittelgroßen Unternehmen noch zu wenig ernsthaft auseinandergesetzt.
Niemand spricht vom Radio
Die No-Billag-Initiative will auch dem Radio die Gebühren und damit die Existenzgrundlage nehmen. Warum spricht kaum jemand vom drohenden Ende von SRF 1, Musikwelle und Virus?
Ein Hintergrundartikel, erschienen am 7. Februar 2018 in der Südostschweiz und der Nordwestschweiz / Aargauer Zeitung.
Täglich schalten 2,6 Millionen Menschen einen der sechs SRF-Radiosender ein. Wer einem dieser Programme zuhört, tut dies im Schnitt fast zwei Stunden lang. Diese Zahlen sind derart beeindruckend, dass sogar das rechtskonservative Politmagazin «Weltwoche», das die No-Billag-Initiative befürwortet, konstatieren musste: «Hier ist tatsächlich ein bemerkenswerter Kohäsionsfaktor vorhanden, weil eine Mehrheit der Schweizer dem gleichen Informationskanal vertraut.» Nicht nur die Quoten, auch die Glaubwürdigkeit spricht für die SRG-Radios: In der aktuellen Mediabrands-Studie von Ende 2017 belegt SRF1 knapp hinter der NZZ den zweiten Rang in der Deutschschweiz, während die beiden SRG-Kanäle La Première und Rete Uno in der Romandie respektive im italienischsprachigen Landesteil die Nase vorn haben.
Eine Annahme der No-Billag-Initiative entzöge allen SRG-Stationen die Gebühren, weshalb nicht nur die Fernseh-, sondern auch die Radiosender ihren Betrieb aufgeben würden. «Die gesamte SRG würde liquidiert – dies ist nach wie vor unser einziger Plan B», betont SRF-Direktor Ruedi Matter (64). Obwohl seine Radio- die TV-Sender punkto Beliebtheit übertreffen, sind letztere im Abstimmungskampf das dominierende Thema. Warum eigentlich?
«Fernsehen ist farbig und prominent und fordert Aufmerksamkeit, was entsprechend Angriffsfläche bietet», sagt Lis Borner (58), Chefredaktorin von Radio SRF und damit Vorgesetzte von knapp 300 Journalisten. Radio hingegen begleite durch den Alltag, informiere, unterhalte und schaffe Stimmungen. «Wer eine emotionale und medienwirksame Kampagne führen will, fokussiert deshalb aufs Fernsehen.» Das tun sowohl das Initiativkomitee als auch die Gegner des Volksbegehrens: Während Olivier Kessler und Co. TV-Sendungen wie der «Arena» unausgewogene Berichterstattung vorwerfen, hört man von ihnen nahezu nie ein schlechtes Wort über Radio SRF; und auch die Vertreter des Nein-Lagers setzen in ihrer Argumentation primär auf den Fernsehbereich, in dem nach ihrer Lesart eine «Berlusconisierung» droht, wo Private die in der direkten Demokratie so wichtigen Informationen nicht bereitstellen könnten.
Einer, der beide Welten aus dem Effeff kennt, ist Nik Hartmann. Die SRF-Allzweckwaffe wird Mitte März – wenige Tage nach der No-Billag-Abstimmung – letztmals als Moderator im Vorabendprogramm von SRF 3 zu hören sein. Nach fast zwei Jahrzehnten beim Radio will er sich künftig auf seine TV-Projekte wie «SRF bi de Lüt» und «Landfrauenküche» konzentrieren. Wenn man im Fernsehen etwas verzapfe, habe dies eine viel grössere Wirkung als im Radio, sagt der 45-Jährige. «Radio ist und bleibt der gute, verlässliche Kumpel im Hintergrund. Da gibts viel weniger Angriffsfläche als bei der bunten Diva Fernsehen.» Auch wenn sich die beiden Medien schwer vergleichen liessen: Beim öffentlichen Auftritt von Radio und Fernsehen hat Hartmann Unterschiede ausgemacht: «Wir Schweizer mögen Bescheidenheit», sagt er. «Und da mag die Wirkung des Radios eine leisere sein als die des Fernsehens.»
Die SDA streikt – Chefs bleiben kompromisslos
Die Mitarbeiter der Nachrichtenagentur SDA sind in einen unbefristeten Streik getreten. Ihre Chefs reagieren wütend – und wollen sich bald zu einer Krisensitzung treffen.
Ein Streikbericht, erschienen am 31. Januar 2018 in der Südostschweiz und der Nordwestschweiz / Aargauer Zeitung.
Der Zufall will es, dass der Demonstrationszug der SDA-Journalistinnen und -Journalisten gestern Mittag in der Stadt Bern auf Bundesrat Ueli Maurer trifft. «Helfen Sie uns», fordert ihn ein Mitarbeiter der Schweizerischen Depeschenagentur auf. Der SVP-Finanzminister aber hat kein Gehör für die Sorgen der Angestellten, die sich gegen den Abbau von mehr als einem Viertel ihrer Arbeitsplätze wehren. «Sie helfen uns ja auch nie», sagt er, verweigert die Entgegennahme eines Flugblattes und schreitet davon.
Einige Stunden bereits streikt die SDA-Belegschaft zu diesem Zeitpunkt. Und sie wird dies auch heute tun. «Wir stossen bei der Geschäftsleitung auf taube Ohren», sagt Redaktionssprecher Sebastian Gänger. «Unser Vertrauen in CEO Markus Schwab ist zerstört. Wir streiken, bis der Verwaltungsrat ernsthafte Verhandlungen mit uns beginnt.» Die Redaktion stört sich nicht nur am Personalabbau, sondern vor allem auch an der Art und Weise, wie die Kündigungen vollzogen werden – innert weniger Tage, ohne Erklärung, mit gehörigem Druck auf jeden einzelnen.
(…)
Spätestens mit Streikbeginn ist die Krise ganz oben im Unternehmen angekommen. Verwaltungsratspräsident Hans Heinrich Coninx verweigerte gestern jede Stellungnahme. Sein Vize Hanspeter Lebrument, der auch Verleger der «Südostschweiz» ist, bestätigte immerhin, dass sich der Verwaltungsrat noch diese Woche zu einer ausserordentlichen Sitzung treffen wolle. Auch in diesem Gremium rumort es: Mit Sandra Jean hat die einzige Journalistin im Verwaltungsrat am Freitag aus Solidarität mit der Belegschaft ihren Rücktritt erklärt. Darüber hinaus wollte sich Lebrument bloss als Verleger und damit als SDA-Kunde äussern: «In einem fairen Arbeitskampf kündigt man Streikmassnahmen ein paar Tage im Voraus an, damit sich die Gegenseite vorbereiten kann», sagte er. «Dass die Mitarbeiter dies unterlassen haben, ist skandalös.»
Im Bundesrat ist mehr Verständnis für die Streikenden vorhanden als bei den Verlegern. «Es gehört zur Schweiz, dass Arbeiter sich wehren können», sagte Medienministerin Doris Leuthard dem Onlineportal «nau.ch». Gemäss Recherchen der «Südostschweiz» macht Bundespräsident Alain Berset die SDA heute auch bei der Bundesratssitzung zum Thema.
Alle Parteien kritisieren die SDA-Spitze
Nach dem Streik der Belegschaft gerät die Führung der Nachrichtenagentur unter öffentlichen Beschuss. Kann sich ihr CEO im Amt halten?
Ein Bericht über die Vorgänge bei der Schweizerischen Depeschenagentur, erschienen am 26. Januar 2018 in der Südostschweiz sowie der Aargauer Zeitung / Nordwestschweiz.
Journalistinnen und Journalisten der Schweizerischen Depeschenagentur, die streiken: Nie in der 123-jährigen Unternehmensgeschichte hatte es so etwas gegeben – bis die 180 Mitarbeiter am vergangenen Dienstag ihre Arbeit niederlegten und so gegen den von der Geschäftsleitung beschlossenen massiven Personalabbau protestierten. Noch im Januar sollen 40 der 150 Vollzeitstellen abgebaut werden, mit Kündigungen, Frühpensionierungen und Pensenreduktionen. Etwas zu sagen haben die SDA-Angestellten nicht: Redaktorinnen und Redaktoren, die nicht innert weniger Tage einwilligen, werden entlassen.
Für ihr unzimperliches Vorgehen werden die Entscheidungsträger der einzigen vollwertigen Schweizer Nachrichtenagentur von Politikern aller Parteien harsch kritisiert. «Was der Verwaltungsrat und die operative ‹Führung› derzeit liefern, ist unter jeder Kanone», schrieb CVP-Chef Gerhard Pfister auf Twitter. «Der CEO verdient sich eine goldene Nase auf dem Buckel des Journalismus.» Auf Anfrage ergänzt Pfister, er halte die hohen Löhne, die die SDA-Manager selbst auf dem Höhepunkt der Krise ihres Unternehmens einstreichen würden, für unverschämt. «Sie ziehen die Sanierung innert weniger Tage und gegenüber ihren Mitarbeitern total kompromisslos durch. Damit handeln sie unternehmerisch unverantwortlich.»
Auch die Zürcher SVP-Nationalrätin Natalie Rickli sagt, die SDA-Führung habe «offensichtlich versagt» und sei für das momentan herrschende Chaos verantwortlich. «Sie hat nicht vorausschauend geplant und schlecht kommuniziert.» Um Ruhe in die Diskussion zu bringen, müsse sie Transparenz schaffen – «bis hin zur Offenlegung der Cheflöhne». Von Gewerkschaftern wird der Lohn von CEO Markus Schwab auf rund 450’000 Franken pro Jahr und damit auf Bundesratsniveau geschätzt. Er selbst sagte in der Vergangenheit bloss, sein Lohn sei «marktkonform».
(…)
Die Vorgänge bei der SDA haben gemäss Recherchen der «Nordwestschweiz» eine erste Konsequenz: Die Eidgenössische Medienkommission empfiehlt nun, die Nachrichtenagentur in der neuen Verordnung über das Radio- und TV-Gesetz nicht wie geplant explizit als «förderungswürdig» zu nennen. Noch am Dienstag hatte sich SDA-CEO Schwab zuversichtlich gezeigt: «Die Unterstützung des Bundes im Umfang von zwei Millionen Franken ab 2019 erfolgt zweckgebunden für die Erfüllung eines Leistungsauftrags», sagte er. «Sie ist fest eingeplant und sollte wegen der Umstrukturierung nicht in Gefahr sein.» Allzu sicher sollte er sich jetzt nicht mehr sein.
Antanzen muss die SDA-Spitze demnächst bei der zuständigen Kommission des Nationalrats. Dies bestätigt deren Präsidentin Edith Graf-Litscher auf Anfrage. «Ich habe die Geschäftsleitung zu einer Anhörung am 13. Februar eingeladen», sagt die Thurgauer Sozialdemokratin.